Andreas Bee Eine posierende Familie
Philip Tsiaras wurde 1952 in New Hampshire geboren und lebt seit 1978 in New York City. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war seine Familie aus Griechenland in die Vereinigten Staaten emigriert. Tsiaras’ Zeichnungen, Malereien, Keramiken und seine Arbeiten in Glas sind auf zahlreichen Ausstellungen in den USA und Europa zu sehen gewesen. Seine Fotografien hingegen wurden bisher nur sehr selten gezeigt.
Das „Family Album”, dessen gröbter Teil Mitte der achtziger Jahre entstand, gehört zu seinen persönlichsten Arbeiten. Was den Betrachter spontan für die Fotografien einnimmt, ist die authentische Atmosphäre der familiären Welt. Die Fotografien sind offensichtlich inszeniert, und doch gewinnt man den Eindruck, als seien die divergierenden Momente im Bild durch ein starkes emotionales Band verknüpft. Fragen entstehen: Wie gelingt es Tsiaras – zumeist Mittelpunkt und Star der Aufnahmen -, Mutter und Tanten, einen Onkel und den Vater zu animieren, nach seinen Regeln mitzuspielen? Wie schafft er es, seine modernen, amerikanisch geprägten Vorstellungen von einer individuellen Lebengestaltung der traditionell konservativen, durch überlebte Konventionen bestimmten Welt einer griechischen Emigrantenfamilie einzupflanzen?
„Ich sagte ihnen (meiner Mutter und den Tanten), daß, wenn sie mir nicht helfen würden, sie meiner Karriere schaden würden. Im Grunde arbeitete ich also mit ihrem Schuldgefühl. Natürlich vertrauten sie mir, aber sie waren gleichzeitig auch besorgt, denn sie wollten nicht lächerlich erscheinen. Die Frauen waren großartig. Sie schienen zu verstehen, was die Kamera wollte. Die Männer waren eher hölzern. Sie lehnten die Grundidee ab und posierten nur widerstrebend. Die Frauen erschienen neu belebt, angeregt. Sie hielten Kind/Mann in den Armen und zwar beide in ihrer Unterwäsche. Eine Art erotisches Kontinuum.”
Letztlich sind alle an den Aufnahmen Beteiligten für das Zustandekommen der Bilder mitverantwortlich. Jeder ist sich in der Inszenierung mehr oder weniger seiner Rolle bewußt, jeder schaut sich und seinen Phantasien selbst zu. Nicht selten hat man den Eindruck, als drückten die Beteiligen nicht ihre Gefühle aus, sondern würden im Gegenteil von diesen vorgeführt. Ambivalenz ist das eigenteil von diesen vorgeführt. Ambivalenz ist der eigentliche Kernpunkt von dieser Sammlung. Der Blick springt hin und her, wie zwischen komplementären Farbfeldern einer konkreten Malerei: Mutter – Sohn, Sohn/Mutter – Vater/Onkel, Jugend – Alter. Die Intensität der Fotografien verdankt sich dabei zu einem erheblichen Teil der wechselseitigen Verunsicherung und gegenseitigen Motivation der Akteure. In den meisten Bildern gibt es ja keinen hinter der Kamera agierenden Fotografen. Alle zusammen bilden eine Gruppe von Spielern, die sich vor dem Apparat, der sich selbst auslöst, zur Schau stellen, dabei verabredeten Regeln gehorchend und der eigenen Intuition vertrauend.
Das Unbestimmbare, Offene, mit dem uns Tsiaras konfrontiert, ist sorgfältig kalkuliert und in der Wirkung ausgesprochen hinterhältig. Jeder, der die Bilder betrachtet, begegnet irgendwann sich selbst. Spätestens dann, wenn er beginnt zu interpretieren und assoziieren. So darf man etwa vermuten, daß der Sohn, der seine geheimen, ödipalen Wünsche in der Realität verdrängen muß, sich diese dennoch in einer sublimierten Form, die unsere Kultur gestattet, erfüllt. Auf der anderen Seite sind es aber auch die Mutter und die Tanten, die hier unter den Bedingungen der Kunst das ihnen gesellschaftlich zugewiesene Territorium verlassen und das Kind sowie den (erotischen) Mann in den Arm nehmen dürfen. Um die eingeübten und gewohnten Regeln, denen die Familienbeziehungen folgen, kurzzeitig außer Kraft setzen zu können, bedarf es offenbar eines Appells an etwas Höheres wie die Kunst. Dadurch erst wird die Versöhnung einander eigentlich ausschließender Triebe und Motive möglich. Doch sogleich schiebt eine gehörige Portion Ironie und Witz, die in den meisten Aufnahmen mitschwingt, solch einseitig psychologischen Interpretationsversuchen sofort wieder einen Riegel vor.
Im Grunde gibt es nichts Banaleres als das eigene Familienalbum. Diese Bildersammlungen sind für gewöhnlich der Versuch sich der eigenen Identität zu versichern oder sich eine solche überhaupt erst zu schaffen. So privat diese Alben auch erscheinen mögen, so schließen sie wirkliche Privatheit und Authentizität des einzelnen doch völlig aus. Jedem Familienalbum eignet etwas Besonderes, und dennoch ist es Teil einer Gemeinschaft, in der Konventionen das Verhältnis von Dialog und Selbstbezüglichkeit regeln. Das „Family Album” von Philip Tsiaras zielt auf die kollektive Biographie der Betrachter.
„Ich hatte mir vorgenommen”, sagt Tsiaras, „etwas zu tun, was das System üblicher Fotoalben aufbricht. Deshalb beschloß ich, mich immer in Unterhosen zu fotografieren.
Nicht nackt, nackt wäre zu stark, wäre ein Affront gewesen. Nur in meiner Unterwäsche aufzutreten, war gerade noch akzeptabel und gleichzeitig schon empörend. Das Interessante war, daß meine sehr konservative Familie zuerst schokiert war, aber gleichzeitig war ich völlig überrascht, wie sehr sie sich bald im konzeptuellen Sinne entwickelt und eingebracht haben. Es dauerte eine gehörige Zeit, ihr Vertrauen zu gewinnen. Anfänglich war die ganze Sache fremd und unangenehm für sie, aber nach und nach konnte ich sie überzeugen, daß das, was sie taten, etwas war, das mir helfen würde, eine interessante und wichtige Arbeit zu machen.”
Tsiaras unterwirft sich seiner Familie und versucht sie gleichzeitig zu dominieren. Auf der einen Seite zeichnet er das altertümliche, behagliche Klima des Elternhauses nach, auf der anderen beherrscht er als junger Held die hinfällige Szenerie. Anonymität und Vertrautheit zugleich kennzeichnen diese Bilder. Anonym und distanziert wirken sie, weil der Betrachter weder den Künstler noch seine Verwandten und meist auch nicht den traditionellen Hintergrund kennt. Die Einrichtung des Hauses, die aus Erinnerungsstücken arrangierten Stilleben und nicht
zuletzt die Gesichter der Menschen berichten von einer verlorenen, aber noch nicht völlig vergessenen Welt. Vertrautheit entsteht immer dort, wo wir unseren eigenen Erinnerungen und Phantasien begegnen und uns in der einen oder anderen Sache wiedererkennen.
Lelbst die klar und übersichtlich gebauten, schnell überschaubaren Bilder dieses Albums können ausgesprochen tiefgründig sein: vor einer aus weißen Ziegelsteinen gemauerten Wand agieren Mutter und Sohn. Tsiaras steht erhöht auf einem nicht sichtbaren „Sockel”. Er zeigt einen Teil des nackten Oberkörpers von der Seite, die mit einem Handtuch umschlungenen Hüften und einen Teil der Beine. Kopf, Schulterbereich und der linke, nach oben gestreckte Arm sind nicht im Bild zu sehen und geben so den Blick auf den Brustkorb frei. Die Hand des rechten, herabhängenden Armes hält eine kleine Kopie der berühmten Statue des David von Michelangelo aus Florenz. Die etwas tiefer stehende Mutter umschlingt von hinten mit beiden Armen die Hüften ihres Sohnes. Sie trägt ein Hemd, das mit Formen und Farben ä la Joan Miro bedruckt ist, und scheint sich ganz auf das genüßliche Riechen der Haut zu konzentrieren. Ironisch gebrochen wird die Szenerie durch die Replik der Statue Michelangelos und das der abstrakten Malerei entliehene Hemdmuster. Wie David den gegen Goliath zu schleudernden Stein lässig in der rechten Hand hält, so wird die Miniatur der Statue Michelangelos wie beiläufig gehalten. War der David von 1504 ursprünglich Symbol einer selbstbewußten männlichen Körperlichkeit und zugleich Darstellung einer freien und unabhängigen Weltanschauung, so ist die Nachbildung Ausdruck der Verkitschung all dieser Werte. Der puren, sinnlichen Köperlichkeit von Tsiaras/David steht die verhüllte Leiblichkeit der Frau und Mutter gegenüber. Hier klingt ein ganz besonderes Gefühlsverhältnis zwischen Mutter und Sohn, Frau und Mann an. Genau bestimmen läßt sich dieses Verhältnis allerdings nicht. Wie immer bleibt es bei einem Sowohl-als-auch.
Die für die meisten Fotografieren typische Zwiespältigkeit verhindert am Ende jeden Versuch einer eindeutigen Klärung. Wer, so kann man fragen, amüsiert sich hier über wen? Die Mutter über den selbstverliebten Sohn, der Sohn über die ihm anachronistisch anmutende Art der Mutterliebe? Die Emotion über den Intellekt? Wie ist das Verhältnis von Mann und Frau, Jugend und Alter, selbstbewußter Körperlichkeit und Körperfeindlichkeit, Verhülltem und Enthülltem, autonomer Formensprache und Gegenständlichkeit, von Miro und Michelangelo zu deuten? Es scheint, als ob Extreme ihr Spiel miteinander trieben. Dadurch reichen die Fotografien weit über das individuell Bedingte hinaus. An der Frage, wie weit wir die subtil kalkulierte Offenheit für uns nützen können, entscheidet sich, welche Position wir gegenüber den Bildern des „Family Album” einnehmen.
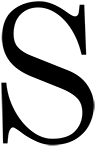

Read recent articles
IMMAGINI, IMMAGINI, IMMAGINI
Denis Curti L’ancien domaine
Denis Curti Der alte Besitz